Zuletzt aktualisiert am:
In der Schmerz-Psychotherapie möchte ich Menschen darin unterstützen neue Handlungsmuster zu entwickeln, und konstruktive Wege im Umgang mit ihrem chronischen Schmerz, zu finden.
Ich möchte bewirken, dass Schmerz besser verstanden, belastende Muster erkannt, und die emotionalen und mentalen Seiten des Menschen gestärkt, werden. Betroffene können wieder mehr Einfluss auf das eigene Leben zurückgewinnen.
Dabei geht es nicht nur um die reine Symptomkontrolle, oder um „Funktionieren“, sondern auch darum, wieder Zugang zu Lebensfreude und innerer Stabilität zu finden.
Chronische Schmerzen betreffen nicht nur den Körper, sie verändern das ganze Leben. Wer mit anhaltenden Schmerzen lebt, kennt nicht nur die körperlichen Herausforderungen, sondern auch das Gefühl, nicht verstanden zu werden. Viele Betroffene erleben Ablehnung, Unglauben oder Gleichgültigkeit – im privaten Umfeld, im beruflichen Kontext, manchmal sogar in der medizinischen Versorgung.
Dieser Text ist aus persönlicher und beruflicher Erfahrung entstanden. Als jemand, der selbst eine eigene Schmerzgeschichte mitbringt und zugleich in der Schmerz-Psychotherapie tätig ist, ist es mir ein großes Anliegen, einen Raum zu schaffen, in dem Schmerz ernst genommen wird, in all seinen körperlichen, seelischen und sozialen Dimensionen.
Schmerzen ernst nehmen
In meiner eigenen Schmerzbiographie habe ich erleben müssen, dass viele Menschen um mich herum, meine Schmerzen nicht ernst genommen haben. Oder dass meine Schmerzen heruntergespielt wurden. Oder dass die Menschen auf Dauer mit den Folgen und Auswirkungen meiner Schmerzen nicht umgehen konnten.
Auch von anderen Betroffenen, ob in örtlichen Selbsthilfegruppen oder im Internet, höre und lese ich immer wieder davon, dass sich Menschen mit chronischen Schmerzen nicht ernst genommen fühlen. Weder im familiären Umfeld, noch unter Freunden oder beim Arbeitgeber und den Kollegen. Am Schlimmsten noch: Sogar Ärzte nehmen Personen und ihre Anliegen oft nicht ernst.
Menschen mit chronischen Schmerzen fühlen sich also sehr oft allein gelassen.
In der Schmerz-Psychotherapie ist es mir daher ein sehr wichtiges Anliegen, den Menschen mit seiner ganzen Schmerzgeschichte anzuhören.
- Wie und wann ist der Schmerz entstanden?
- Welche Auswirkungen hat er auf Ihr Leben, Ihre Stimmung, Ihre Beziehungen, Ihre Arbeit?
- Was haben Sie bereits versucht/unternommen um den Schmerz zu lindern?
Dabei ist es für mich von zentraler Bedeutung, dass Sie sich ernst genommen fühlen, mit all dem, was Sie erlebt und durchgestanden haben. Nichts wird heruntergespielt oder relativiert.
Stattdessen biete ich einen Raum, in dem das individuelle Erleben des Schmerzes gesehen, verstanden und angenommen werden darf.
Psychoedukation – oder: Was ist eigentlich Schmerz?
Wenn ein Klient, der an chronischen Schmerzen leidet, in meine Praxis kommt, ist es mir sehr wichtig, dass wir uns das Thema Schmerzen von Grunde auf anschauen.
Wie entstehen Schmerzen? Was läuft bei Schmerzen auf der physiologischen (körperlichen) Ebene ab? Was bewirken Schmerzen?
Chronischer Schmerz ist keine Einbildung. Schmerz ist auch nicht einfach eine Verletzung, die nicht, oder schlecht, abheilt. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel aus körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren.
Das Nervensystem spielt dabei eine zentrale Rolle. Chronische Schmerzen sind oft ein echtes, häufig fehlgeleitetes, Alarmsignal des Nervensystems. Dieses kann überempfindlich werden, sich gewissermaßen „an Schmerz erinnern“ auch wenn keine akute Schädigung oder Verletzung mehr vorliegt.
In der Psychoedukation vermittle ich verständliches Wissen darüber
- wie Schmerz entsteht,
- wie das Nervensystem lernt und reagiert,
- welche Rolle Gedanken, Gefühle und Stress dabei spielen können, und
- warum Schmerz chronisch werden kann, selbst wenn medizinisch keine eindeutige Ursache mehr zu finden ist.
Dieses Wissen über Schmerzen ist keine reine Kopfsache, sondern ein erster, entscheidender Schritt zur Veränderung. Wer begreift, dass Schmerz „gelernt“ werden kann, kann auch anfangen, neue Wege im Umgang mit diesem zu lernen.
Psychoedukation in der Schmerz-Psychotherapie bedeutet also, den Schmerz verstehen lernen und darüber zu mehr Selbstwirksamkeit und Handlungsspielraum zu finden.

Individuelle Belastungsfaktoren – oder: Was kann Einfluss auf Schmerzen haben?
Dieser Schritt ist auf Ihrem Weg besonders wichtig. Denn wenn Betroffene erkennen, was sie belastet, und wie das Nervensystem dadurch in dauerhafter Alarmbereitschaft bleibt, können genau dort neue Wege heraus gefunden werden. Es geht nicht darum, den Schmerz „wegzumachen“, sondern die Bedingungen zu verändern, unter denen Schmerz entsteht, verstärkt, oder aufrechterhalten, wird.
In der Schmerzpsychotherapie schauen wir deshalb gemeinsam darauf, welche inneren und äußeren Belastungsfaktoren eine Rolle spielen, und zwar ohne Schuldzuweisung, sondern mit dem Ziel, besser zu verstehen und gezielt ansetzen zu können.
Dabei betrachten wir gemeinsam:
- Ihre Stressbelastung: Wie stark ist Ihr Alltag von Anspannung, Druck oder Überforderung geprägt?
Wie wirken sich berufliche, familiäre oder soziale Anforderungen auf Ihren Körper aus? - Ihre emotionalen Belastungen: Gibt es unverarbeitete Erfahrungen, Trauer, Konflikte oder wiederkehrende Gefühle wie Angst, Wut oder Hilflosigkeit, die den Schmerz beeinflussen könnten?
- Ihre innere Haltung und Glaubenssätze: Viele Menschen mit chronischen Schmerzen erleben sich selbst als „zu schwach“, „nicht belastbar genug“ oder „nicht mehr richtig funktionierend“. Solche Gedanken können zusätzlichen inneren Stress erzeugen.
- Ihre körperlichen Schonhaltungen und Verhaltensmuster: Was vermeiden Sie aus Angst vor Schmerz? Wo geraten Sie vielleicht immer wieder in ein Muster zwischen Überlastung und Rückzug?
- Ihr soziales Umfeld: Wie reagieren andere auf Ihren Schmerz? Gibt es Unterstützung, oder eher Missverständnisse, Druck oder Rückzug?
Das Verständnis über die individuellen Belastungsfaktoren ist ein zentraler Schlüssel:
Es ermöglicht gezielte Veränderung und macht deutlich, dass man dem Schmerz nicht hilflos ausgeliefert sind.
Handlungsspielräume erweitern – oder: Neue Wege im Umgang mit Schmerz?
Wenn Schmerzen über längere Zeit das Leben bestimmen, verengen sich oft die Handlungsspielräume. Viele Betroffene erleben sich im ständigen Wechsel zwischen Durchhalten und Erschöpfung, zwischen Rückzug und dem Gefühl, funktionieren zu müssen.
In der Schmerz-Psychotherapie geht es darum neue, alltagstaugliche und individuelle Wege zu entwickeln, um dem Schmerz anders zu begegnen, und damit wieder mehr Kontrolle und Lebensqualität zurückzugewinnen.
Was kann sich konkret verändern?
- Achtsamkeit und Selbstregulation lernen
Viele Menschen reagieren auf Schmerz automatisch mit Anspannung, Vermeidungsverhalten oder Grübeln. Achtsamkeit kann helfen, innezuhalten und wahrzunehmen, ohne sofort reagieren zu müssen.
Es geht darum, wieder einen inneren Abstand zum Schmerz zu gewinnen und sich nicht völlig von ihm bestimmen zu lassen. - Umgang mit schmerzbezogenen Gedanken und Gefühlen
Schmerz ist nicht nur körperlich. Er löst Gedanken aus („Es wird nie wieder besser“, „Ich schaffe das nicht“) und weckt Gefühle wie Angst, Wut oder Hilflosigkeit. Diese inneren Reaktionen können den Schmerz verstärken.
In der Psychotherapie arbeiten wir daran, diese Muster zu erkennen, und neue, hilfreichere Perspektiven zu entwickeln. - Realistische Aktivitätssteigerung & Tagesstruktur
Ein typisches Muster bei chronischem Schmerz ist der „Boom-and-Bust-Zyklus“ („Auf- und Abschwung-Zyklus“): An guten Tagen wird zu viel gemacht – an schlechten Tagen folgt der Rückzug.
Ziel ist es, hier eine ausgewogene Struktur, mit kleinen, aber regelmäßigen Aktivitäten, zu entwickeln, die sowohl Belastung als auch Erholung einplanen. - Selbstfürsorge & Abgrenzung stärken
Viele Menschen mit chronischen Schmerzen setzen sich selbst unter Druck, oder stellen eigene Bedürfnisse zurück. Dies geschieht oft aus Pflichtgefühl, Angst oder Gewohnheit.
In der Therapie geht es darum, mitfühlender mit sich selbst zu werden, die eigenen Grenzen erkennen zu lernen, und sich innerlich wie äußerlich besser abgrenzen zu können. - Ressourcen fördern & Sinn wiederfinden
Was tut mir gut? Was gibt mir Energie, Freude, Ruhe oder Verbundenheit, auch wenn der Schmerz da ist? „Neue Wege im Umgang mit Schmerz“ bedeutet nicht, ihn „wegzumachen“, sondern wieder mehr von dem zu leben, was das Leben für jeden Menschen individuell lebenswert macht.
Veränderung beginnt oft in kleinen Schritten – und sie ist möglich.
Sie bedeutet nicht, den Schmerz zu ignorieren, sondern ihm den Platz zu geben, den er braucht, ohne dass er alles dominiert.
Stärkung von Selbstwirksamkeit – oder: ich bin mehr, als mein Schmerz!
Chronischer Schmerz nimmt oft nicht nur körperliche Energie, er greift auch das Vertrauen an, das eigene Leben gestalten zu können. Viele Betroffene fühlen sich dem Schmerz ausgeliefert, erleben Hilflosigkeit, Kontrollverlust und Resignation.
Ein zentrales Ziel der Schmerz-Psychotherapie ist es deshalb, die eigene Selbstwirksamkeit wieder zu stärken und den Zugang zu Lebensqualität zurückzugewinnen, Schritt für Schritt, in einem Tempo, das zu Ihnen passt.
- Selbstwirksamkeit bedeutet: Ich kann etwas bewirken
Auch wenn der Schmerz nicht verschwindet, es gibt immer Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf das Denken, Fühlen und Handeln. In der Therapie erleben viele Menschen: „Ich bin nicht machtlos. Ich kann mir selbst helfen. Ich kann kleine Schritte gehen, und sie zeigen Wirkung.“
Diese Erfahrung verändert oft mehr als jede Technik: Sie stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die eigene Stimme, in die eigene innere Kraft. - Was macht mein Leben lebenswert – trotz oder mit dem Schmerz?
Ein weiterer Fokus liegt darauf, wieder Lebensqualität zu spüren, im Kleinen, wie im Großen. Auf den Weg dahin gehören zum Beispiel Fragen wie: „Was tut mir gut?“, „Was möchte ich (wieder) mehr in mein Leben holen?“ oder „Was ist mir wichtig, was gibt mir Sinn?“. Manchmal geht es um kreative Tätigkeiten, manchmal um soziale Kontakte, Bewegung, Natur, Ruhe oder spirituelle Erfahrungen. Es geht nicht um „funktionieren“, sondern darum, lebendig zu sein, auch mit Schmerz. - Eigene Strategien entwickeln und festigen
Zum Abschluss der Therapie geht es oft darum, die hilfreichen Strategien aus dem gesamten psychotherapeutischen Prozess zu bündeln:
– Welche Übungen, Gedanken, Rituale oder Haltungen haben sich bewährt?
– Wie kann ich mich selbst unterstützen, auch in schwierigen Phasen?
– Was hilft mir, dran zu bleiben?
Gemeinsam erarbeiten wir einen individuellen „Werkzeugkoffer“, auf den Sie im Alltag, nach Ihren Möglichkeiten, jederzeit zurückgreifen können.
Selbstwirksamkeit und Lebensqualität bedeuten nicht, dass der Schmerz verschwindet. Aber sie bedeuten, dass er nicht mehr das ganze Leben bestimmt. Dass es wieder Raum gibt. Raum für Freude, Verbundenheit, Gestaltung. Und für das Gefühl: Ich bin mehr als mein Schmerz.
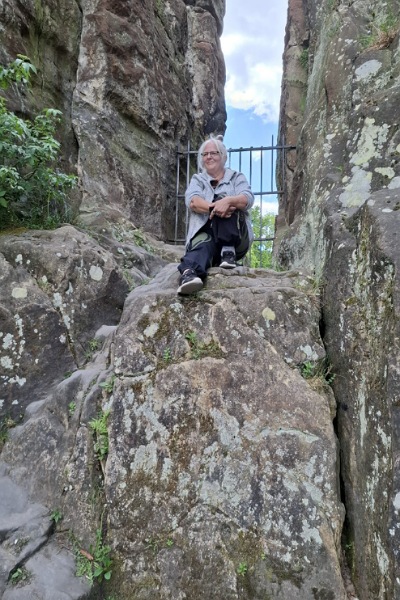
Schmerz muss nicht das ganze Leben bestimmen. In der Schmerz-Psychotherapie geht es darum, den Menschen mit seiner ganzen Schmerzgeschichte anzunehmen und neue Wege im Umgang mit dem Schmerz zu eröffnen.
Sie kann helfen, sich selbst wieder als handlungsfähig zu erleben – mit mehr Klarheit, mehr Vertrauen und mehr Raum für das, was im Leben wirklich zählt.

ÜBER MICH
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum – auch mit Schmerzen!
Das ist die Philosophie, die mich nach vielen Umwegen zu meinem heutigen Beruf als Heilpraktikerin für Psychotherapie geführt hat. Mein eigener Weg mit einer chronische Schmerzerkrankung hat mir gezeigt, dass Heilung nicht immer bedeutet, schmerzfrei zu sein, sondern Frieden mit sich selbst zu schließen und das Leben trotzdem zu gestalten. Ich begleitet Menschen, die ihren Mut und ihre Lebensfreude wiederfinden möchten, auch dann, wenn Körper und Seele erschöpft sind. Dabei verbinde ich Empathie, Lebenserfahrung und fundiertes Wissen zu einer ganzheitlichen Arbeit mit Herz und Verstand.
Mein Ziel: Ihnen zu zeigen, dass jeder Schmerz, körperlich oder seelisch, eine Tür zu Wachstum, Bewusstsein und innerer Stärke sein kann, und Sie auf Ihrem eigenen Weg, in Ihrem eigenen Tempo, zu begleiten.
Mehr über mich gibt es hier zu lesen.
